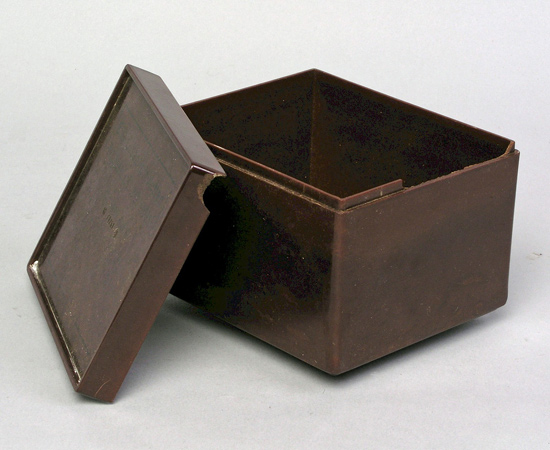Paul Sperber
Vorgeschichte: Von fließenden Kanälen und fließendem Strom
Der 1743 unter dem preußischen König Friedrich dem Großen (*1712-†1786) begonnene Zweite Finowkanal als Verbindung zwischen Havel und Oder sorgte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges für die Ansiedlung zahlreicher Industriebetriebe an seinen Ufern, mit Eberswalde als Zentrum. Die Einführung elektrischen Stroms führte letztlich noch einmal zu einer industriellen Hochkonjunktur sowie Steigerung der Effizienz in der gesamten Produktion. Am Ende des 19. Jahrhunderts waren jedoch weite Teile der Provinz Brandenburg bestenfalls punktuell elektrifiziert. Allein der Großraum Berlin bildete hier eine Ausnahme. An dessen Infrastruktur begannen sich auch die Betriebe entlang des Finowkanals anzuschließen und so stieg hier, wie auch in vielen anderen Landesteilen der Bedarf nach Braun- und Steinkohle als Energieträger kontinuierlich. Die Brikettfabriken der Niederlausitz waren es, welche die Versorgung und damit den Aufbau eines allgemeinen und flächendeckenden Stromnetzes in der Provinz Brandenburg erst ermöglichten und sicherstellten.
Eberswalde, das Kraftwerk und die Elektrizität
In Eberswalde „erstrahlte zum ersten Male elektrisches Licht“ am 07. Februar 1883 im Zwicksaal der Hufnagelfabrik des Geheimen Kommerzienrates Clemens Schreiber (Schmidt 1941, 355). Die Stadt errichtete sich dann 1906 in der Bergerstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gaswerk, ein eigenes Elektrizitätswerk zur Versorgung des Stadtgebietes mit relativ bescheidener Leistung (Schmidt 1941, S. 356).
Aufgrund der noch immer spärlich ausgebauten Elektro-Infrastruktur in Brandenburg „gründete die Berliner AEG im Mai 1909 zusammen mit der Elektrobank Zürich die Aktiengesellschaft Märkisches Elektrizitätswerk (MEW)“ (Rohowski 1997, 219). Die Aufgabe der MEW war es, die Betriebe des Eberswalder Industriebezirks mit elektrischer Energie zu versorgen sowie Anreize für die Ansiedlung neuer Unternehmen zu schaffen. Die Eberswalder Zeitung schrieb damals: „Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung einer Überland-Zentrale für die Kreise Oberbarnim, Niederbarnim, Templin, Angermünde und angrenzende Gebiete“ (Tetzlaff 1996, 132). Aufgrund ihres enormen Verbrauchs war die Industrie für die MEW ein lukrativer Geschäftspartner.
Bereits 1908 war unter der Federführung des renommierten Kraftwerksingenieurs Georg Klingenberg (*1870-†1925) und des Architekten Werner Issel (*1884-†1974) am Ufer des Finowkanals in Heegermühle (heute Finow) mit dem Bau eines solchen Kraftwerks begonnen worden, wofür man etwa zwei Millionen Reichsmark veranschlagt hatte (Sperber 2022, 89) (Abb. 1-3). Hierfür wendete Klingenberg eigene Theorien an, welche er bereits zu seinen Studienzeiten an der Technischen Hochschule Charlottenburg entwickelt und 1913 auch publiziert hatte. Darin definierte er unter anderem, dass die Elektrizitätserzeugung unter maximaler Effizienz zu erfolgen hatte. Dies sollte beispielsweise durch eine entsprechende Gestaltung der Kraftwerksbauten, kompakte und zuverlässig arbeitende, wartungsarme Maschinenanlagen sowie möglichst kurze Verbindungswege erreicht werden. Klingenberg plädierte offen für eine Abkehr vom wilhelminischen Eklektizismus. Nach ihm habe sich die Architektur bis dahin „vielfach in falsche Bahnen bewegt und die selbstverständliche Förderung, daß die Formgebung dem Zwecke des Gebäudes Rechnung tragen muss, ist bisher oft übersehen worden. Man sollte nie vergessen, daß ein Kraftwerk nichts anderes ist als eine Elektrizitätsfabrik […]. Tatsächlich werden aber häufig theaterähnliche Bauten errichtet“ (Klingenberg 1924, S. 393). Der Bau des Kraftwerks Heegermühle erfolgte auch deshalb am Kanal, da dies nach Klingenbergs Maximen die Transportwege etwa für Kohle kurz und kostengünstig hielt. Der ebenfalls eingerichtete Eisenbahnanschluss sicherte die Versorgung doppelt hab, um eine kontinuierliche und zuverlässige Stromproduktion zu gewährleisten.
Begonnen wurde der Bau des Kraftwerks Heegermühle mit dem Kesselhaus im Osten des Komplexes. Jenes 19, später 26,5 Meter lange Gebäude errichtete man in Stahlrahmenkonstruktion, welches mit roten Ziegelsteinen ausgefacht wurde. Nur die Ostseite mit dem großen Tor war massiv gemauert. Bei der Erbauung war das Kesselhaus für die Aufnahme von sechs Kesseln konzipiert, deren Anzahl sich im Laufe der Zeit jedoch auf neun steigern sollte. Jene waren nach Schiffskesselart gebaut und stammten von der Firma Babcock & Wilcox Enterprise Inc. (Abb. 4) Überdacht war das Kesselhaus mit einem flachen Satteldach mit Obergaden. Aus diesem ragten große, trichterförmige Schornsteine aus Eisenblech, je einer pro Kesseleinheit, heraus. Hierzu gehörte auch eine Saugzuganlage der britischen Firma White, Child & Benney. Das Gebäude schloss sich nach Westen hin dem Maschinenhaus an (Abb. 5).
Dieses war ebenfalls in ausgemauerter Eisenfachkonstruktion erbaut worden und bildet in Nord-Süd-Ausrichtung das Herzstück der Anlage. Besonders prägnant ist seine bewusst zum Finowkanal ausgerichtete Südfassade mit den markanten Dreifenstergruppen und Lisenen (Abb. 6). Zur natürlichen Belichtung besaß auch dieses Gebäude Obergaden in seiner mansardartigen Bedachung. Im Inneren gliederte sich das Maschinenhaus grob in den Bereich der Kondensatoren im Erdgeschoss sowie in den Bereich der Generatoren und Turbinen, dem Maschinensaal, im Obergeschoss (Abb. 7-8). Bei seiner Erbauung war dieses Gebäude für die Aufnahme von zwei Dampfturbinen ausgelegt und nahm 1909 seinen Betrieb mit einer Leistung von 7.200 kW auf.
Dem Maschinenhaus schloss sich gen Westen wiederum das Schalthaus an, welches als erstes in der deutschen Kraftwerksgeschichte nicht mit dem Maschinenhaus amalgamiert, sondern alleinstehend platziert wurde. Verbunden war es mit seinem Nachbargebäude nur durch einen freischwebenden, flachgedeckten Verbindungsgang aus Eisenfachwerk. Das dreigeschossige Schalthaus akzentuierte man mit Lisenen und Strebepfeilern, auf der Westseite verbindet ein polygonaler Treppenturm die Geschosse. Der Innenraum (Abb. 9) gliederte sich streng nach den einzelnen Tätigkeitsfeldern, etwa für die Netzeinspeisung, die Elektrizitätsregulierung sowie in Bereiche für die Hoch- und die Niederspannung. Aus Brandschutzgründen waren die einzelnen Trennwende mit feuerbeständigen Duroplatten verkleidet (Klingenberg 1924, 415).
Zum Kraftwerkskomplex gehörten weiterhin der Kohlelagerplatz mit einer Verladebrücke der Firma MAN, ein kleiner Binnenhafen für den Kohleumschlag, eine 100 kV-Freiluft-Umspannstation, ein 1909/1910 errichtetes Verwaltungshaus (Abb. 10), eine 50 kV-Schaltstation sowie mehrere Schuppen, Werkstätten, kleinere Lagerhäuser und Garagen.
Betrieb und Entwicklung bis 1945
Die offizielle Betriebsaufnahme des Kraftwerks Heegermühle am 09. Dezember 1909 markierte auch den Beginn der flächendeckenden Elektrifizierung Brandenburgs – letztlich auch Mecklenburgs und Pommerns – durch die „MEW AG“. Durch den noch im gleichen Jahr unterzeichneten Konzessionsvertrag mit dem Eberswalder Magistrat wurde auch das städtische Elektrizitätswerk an das Kraftwerk (auch Überlandzentrale genannt) angeschlossen. Im Mai 1911 verlegte man bereits die ersten beiden 10.000 V-Mittelspannungsleitungen und bald darauf noch zwei 40.000 V-Hochspannungsleitungen nach dem Königlichen Forst Biesenthal. Schon 1912 wurde die Aufstockung auf sechs Kessel und einen weiteren Generator notwendig. Zu jener Zeit versorgte das Kraftwerk bereits 100 Ortschaften. 1916 bis 1918 folgte noch einmal eine erhebliche bauliche Vergrößerung von Schalt- und Maschinenhaus und man stockte auf neun Kessel auf, wodurch sich eine Spitzenleistung von 20.000 kW ergab. 1924 gehörten bereits 29 Land- und fünf Stadtkreise sowie insgesamt 2.900 Ortschaften zum Betriebssprengel der „MEW AG“. Fünf Jahre später gliederte man zudem die Landeselektrizitätswerke des Freistaates Mecklenburg-Schwerin der „MEW AG“ an. Diese war damit de facto auch für die dortige Elektrifizierung verantwortlich und federführend. Wenig später wurde auch das pommersche Netz inkorporiert.
Am Ende der 1920er Jahre konnte aber auch das Heegermühler Elektrizitätswerk den immer weiter steigenden Strombedarf allein nicht mehr decken. Aufgrund technologischer Fortschritte und moderner Maschinenanlagen wurde es teilweise durch den Bau potenterer Anlagen, wie dem Großkraftwerk Finkenheerd, in den Schatten gestellt, sodass es letztlich in den Rang einer Reserveanlage abstieg. Zur gleichen Zeit stellte die „MEW AG“ ernsthaft die weitere Rentabilität des Kraftwerks Heegermühle in Frage, sodass mittelfristig die Stilllegung zu befürchten war. Durch die künstlich herbeigeführte ökonomische Hochkonjunktur vor dem Hintergrund der Kriegsvorbereitungen der Nationalsozialisten war man jedoch wieder auf die Kapazitäten des Kraftwerks angewiesen, um die Kriegs- und Konsumgüterwirtschaft auszubauen. So erfolgte 1937 erneut ein Ausbau des Maschinenhauses gen Norden und die Steigerung der Kapazität auf 56.000 kW. Zugleich wurde im Zuge der Gleichschaltung auch hier das „Führerprinzip“ eingeführt.
Bis 1945 versorgte das Kraftwerk am Finowkanal die umliegenden und angeschlossenen Betriebe nicht nur mit Elektrizität, sondern darüber hinaus mit eigenen Abprodukten, wie Asche, etwa für den Straßenbau. Die Bedeutung der Anlage lag zu dieser Zeit besonders in der Aufrechterhaltung der Moral der Bevölkerung während des Krieges durch eine stabile Stromversorgung. Trotz der geringeren Bedeutung gegenüber dem Großkraftwerk Finkenheerd, diente das Kraftwerk Heegermühle doch als wichtige Überlandzentrale und integraler Bestandteil der elektrischen Versorgungsader zwischen Finkenheerd und Güstrow. Und auch im Barnim setzte man von Finow aus den Ausbau von weiteren Versorgungsleitungen fort. Während des Krieges erlitt das Kraftwerk Heegermühle selbst praktisch keine äußeren Schäden, lediglich 1944 ereignete sich eine schwere Kabelexplosion mit anschließendem Brand, welcher die Stromproduktion im Werk kurzzeitig einschränkte. Und auch das Leitungsnetz der „MEW AG“ schien durch den Krieg relativ wenig beeinträchtigt gewesen zu sein. So ist aber mindestens ein Fall überliefert, bei welchem die Gendarmerie zu Fürstenberg Ende September 1940 meldete, dass nahe des Gutes Neu-Tornow im Kreis Stargard die 50 kV-Leitung zwischen Zehdenick und Granzin durch einen alliierten Luftangriff mit sechs Sprengbomben, welche zum Teil auch im Tornower Forst einschlugen, leicht beschädigt worden war. Dagegen übernahm die „MEW AG“ während des Krieges mehrere Unternehmen, etwa den polnischen Hersteller für Kabel Ozarow AG in Warschau; ebenso wurde 1940 die Überlandzentrale Friedland inkorporiert. Im Kraftwerk Heegermühle kamen zudem auch französische Kriegsgefangene sowie Frauen zum Einsatz. Durch die sich zunehmend verschlechternde Kriegslage wurden von der Berliner AEG auch immer wieder arbeits- und kostensparende Maßnahmen angeordnet. Erst wenige Tage vor Kriegsende musste auch das Kraftwerk Heegermühle seinen Betrieb einstellen.
Literatur (Auswahl)
Bodenschatz, Harald / Lorenz, Werner / Seifert, Karsten: Das Finowtal in Barnim. Wiege der Brandenburgisch-Preußischen Industrie. Berlin 2000.
Klingenberg, Georg: Bau großer Elektrizitätswerke. Berlin 1924.
Rohowski, Ilona: Denkmale in Brandenburg. Landkreis Barnim. Teil 1: Stadt Eberswalde. Worms am Rhein 1997.
Schmidt, Rudolf: Geschichte der Stadt Eberswalde. Band 2 Von 1740 bis 1940. Eberswalde 1914.
Sperber, Paul: Das Kraftwerk Heegermühle und die industrielle Blüte im Finowtal. Eine architektur-, kunst- und industriehistorische Betrachtung im Kontext der Entwicklung der deutschen Elektroindustrie und dem Aspekt der Baudenkmalpflege (= Zeugnisse der Architekturgeschichte; Bd. 1). Eberswalde 2022.
Sperber, Paul: Einzigartiges Industriedenkmal oder volkseigene Ruine? Die Bedeutung des Kraftwerks Heegermühle als Zeugnis brandenburgischer Industriekultur und elektrotechnischen Pioniergeistes. In: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Hrsg.): Brandenburgische Denkmalpflege. Jahrgang 9. Heft 2. Wünsdorf 2023, S. 57-64.
Tetzlaff, Christian: Das ehemalige Kraftwerk Heegermühle. In: Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e. V. (Hrsg.): Eberswalder Jahrbuch für Heimat-, Kultur- und Naturgeschichte 1996/1997. Eberswalde 1996, S. 126-137.
Abbildungsnachweis
Abb. 1-3, 5-7, 9 Museum Eberswalde.
Abb. 4, 8 Klingenberg, Georg: Das Märkische Elektrizitätswerk; in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure. 1911, S. 2125 (Abb. 4), S. 2128/2129 (Abb. 8).
Abb. 10 Privatsammlung Familie Wühle, Eberswalde.
Empfohlene Zitierweise
Sperber, Paul: Kraftwerk Heegermühle, publiziert am 30.07.2024; in: Industriegeschichte Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)